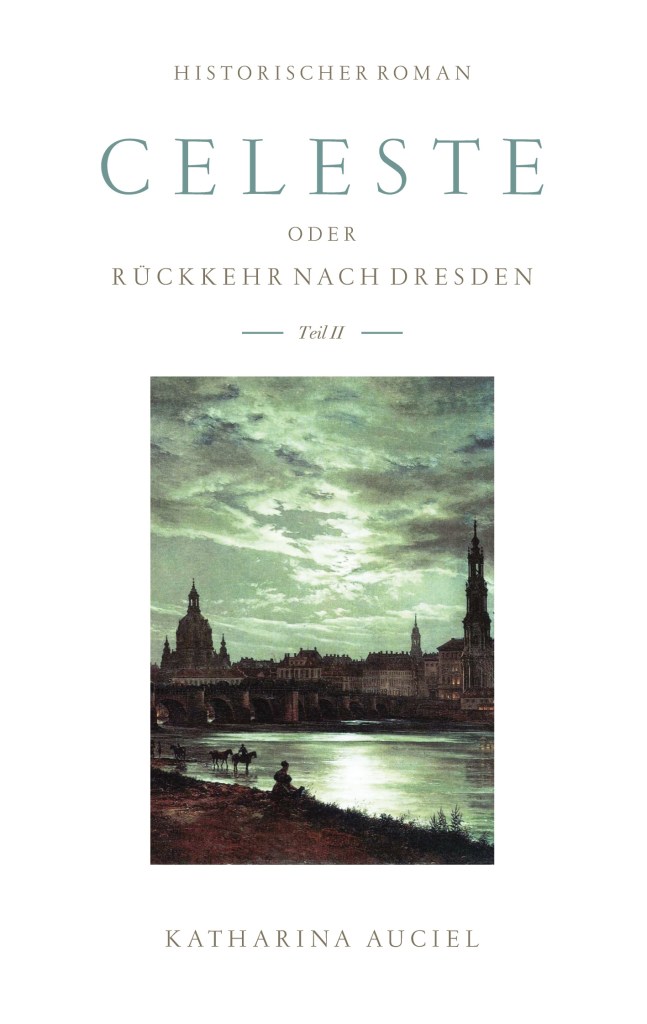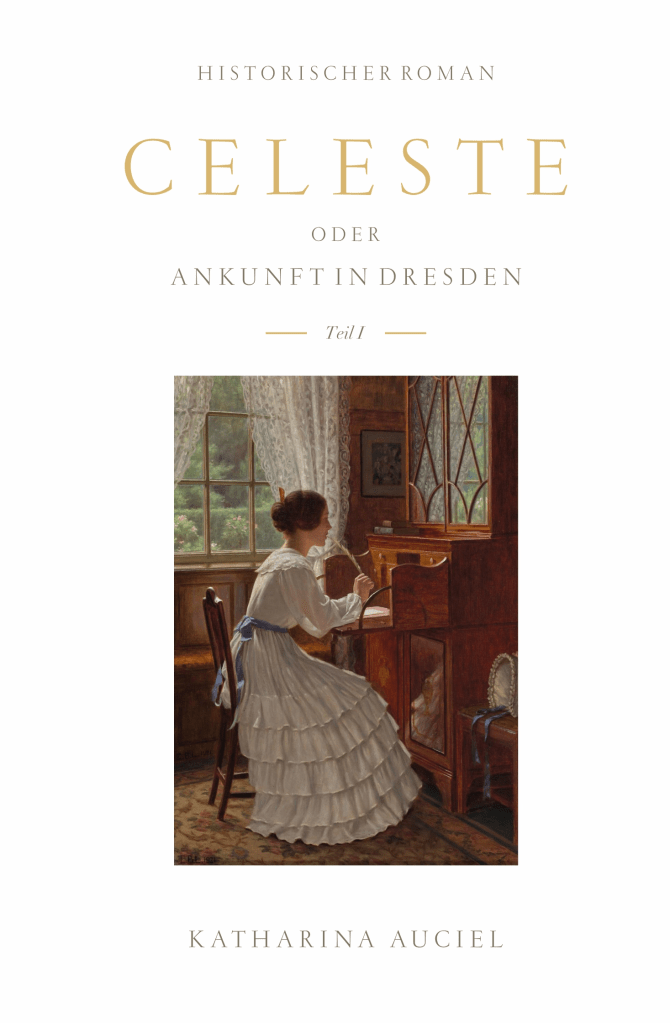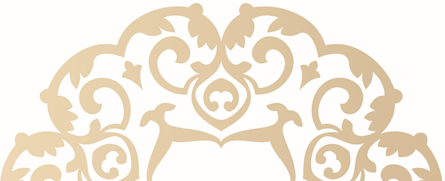In Gedanken über diesen außergewöhnlich heiteren Abend versunken, stieg Celeste die Treppen des nachtstillen Hauses empor. Versonnen öffnete sie die Wohnungstür und trat in den schwach beleuchteten Empfang, der sich großzügig in der gesamten Wohnungslänge als Salon ausdehnte. Bevor sie im vergangenen Juni das neue Heim bezogen, hatte Florian ihn bereits geschmackvoll eingerichtet. An der rückseitigen Wand befand sich vor hohen Fenstern ein großes schweres Sofa mit einem niedrigen Tisch und zwei dazugehörigen Sesseln; an der linken Längsseite gingen die Türen zu Küche und Wirtschaftsräumen ab, dazwischen standen zierliche Vitrinen, die sich nach und nach mit hübschen Dingen hätten füllen sollen. Die vordere Hälfte des Salons beherrschte ein großer ovaler Nussbaumtisch mit sechs graziösen Stühlen, entsprechend dem Stil der Vitrinen. Zur Rechten des Eingangs erstreckte sich im rechten Winkel zum Salon ein Flur, von dem die Schlafzimmer und das Arbeitszimmer zu betreten waren. Zur Linken lagen zwei Bedienstetenkammern.
„Du kommst spät, Celeste.“ Sie fuhr zusammen. Am erwähnten kostbaren Nussbaumtisch, der gleichsam der Blickfang des gesamten Ensembles war, saß Herr Ingenieur Hofstetter und erwartete augenscheinlich seine junge Gemahlin. In dem schwachen Licht nur einer brennenden Kerze war er kaum wahrzunehmen gewesen, und sie hatte ihn auch nicht erwartet. „Hattest du einen amüsanten Abend?“
Entschlossen versuchte sie, die aufkommende Furcht zu beherrschen. „Ja, es war ein schöner Abend …“.
„Warum hast du Angst? Habe ich dir etwas angetan?“
„Nein“, versicherte sie rasch.
„Dann solltest du dich freuen, dass ich dich wenigstens an diesem Abend einmal erwarte. Denn das beklagst du ja, oder nicht? – Die seltenen Stunden, die wir gemeinsam verbringen.“ Verzagt nickte sie. „Dann setzt dich zu mir und erzähle mir, was du heute Hübsches erlebt hast.“
Ungelenk zog sie einen Stuhl hervor und setzte sich, ohne den Mantel abgelegt zu haben. „Es war ein schöner Hausmusikabend … Marianne Ziegler lud mich noch zu einem Abendessen ein.“
„Das ist erfreulich. – Durfte man dich auch musizieren hören?“
„Ja. Zwei Stücke von Adolf Friedrich Hasse … freundlicherweise lobte man mich dafür …“, fügte sie stockend an.
„Das hört man gerne.“ Unbestimmt lächelte er. „Immerhin wollte ich nicht umsonst ein kleines Juwel aus dem stolzen britischen Imperium mitbringen. – Wer war unter dem Publikum?“
„Die meisten Gäste sind mir unbekannt …“.
Vielsagend nickte er. „Gewiss war auch der ein oder andere aus der Familie von Heringsdorf anwesend.“
Ihr Herz klopfte heftig. „Ja. Cäcilia und ihr älterer Bruder …“.
„Ach, schau an! Ist der in der Stadt?“
„Ja.“
Ein kurzes überhebliches Lachen erschütterte ihn. „Der arme Herr von Heringsdorf! Besonders stolz ist er nicht auf seinen missratenen Sohn.“
„Ist er missraten?“
„Ich dachte, du bist ihm begegnet?“
„Dadurch habe ich nicht erfahren können, ob er missraten ist“, war ihre mutige Antwort.
„Ja, schau ihn dir doch an!“ Den abfälligen Blick nach innen gerichtet fuhr er fort. „Allein das Äußere beweist sein Versagen.“
„Ich kenne ihn nicht“, bemerkte sie leise.
„Das ist auch empfehlenswert.“
Sie schwiegen, während sein Blick auf ihr lag, ohne sie zu sehen.
„Florian …?“
Seine Augen erfassten sie nun streng. „Ja, bitte!“
„Ich habe die Anstellung bei Familie von Heringsdorf verloren“, gelang ihr das Geständnis.
„Es ist mir bereits zu Ohren gekommen.“
Betroffen senkte sie den Blick. Nun konnte sie sich diesen abendlichen Empfang halbwegs erklären. Denn war es nicht das, was sie unvorsichtigerweise am Kaffeetisch zum Besten gegeben hatte? Die mangelnde Zuwendung? – Dabei war sie seit Monaten dankbar, wenn sie ihm nicht begegnete.
„Und?“, flüsterte sie.
„Was heißt ‚und‘?“, fragte er barsch.
„Bist du enttäuscht?“, wisperte sie verstört.
Er lachte kurz auf. „So junge Mädchen müssen sich eben noch zügeln lernen. Das weiß auch Herr von Heringsdorf.“
„Hat er dich aufgesucht?“
„Er war in meinem Bureau.“
„Warum?!“, entfuhr es ihr. „Deswegen?“
Er schüttelte den Kopf. „Du bist viel zu neugierig, Fräulein!“ Mit einem sportlichen Satz erhob er sich. „Ich muss noch arbeiten.“
(Seite 125 – 128)