-
Rückkehr nach Dresden
Erste Kostprobe

Celeste folgte den Klängen des Violoncellos. Ihr Vater zog sich hin und wieder in den Wintergarten zurück, um zu musizieren. An diesem Tag spielte er eine Suite von Bach – ihrer Stimmung angemessen, melancholisch.
„Darf ich mich dazusetzen, Vater?“
„Es ist zu kalt, mein Kind! Warte, ich hole dir die Wolldecke aus dem Wohnzimmer.“ Bevor er das Cello zur Seite stellen und aufstehen konnte, war Celeste in das Wohnzimmer gesprungen und nahm sich die Decke.
„Spiel doch etwas Munteres, Vater, oder bist du traurig gestimmt?“
„Nein, nur nachdenklich, und dann kommt mir Bach entgegen. – Möchtest du mich begleiten?“
„Ich wollte dir nur lauschen. – Spielst du aus der sechsten Suite die Gavotte und die Gigue für mich?“
George Avestone suchte eine Weile in seinen Notenblättern, fand das Gewünschte, vertiefte sich in die Noten und zog den Bogen im rasanten Tempo über die Saiten.
Celeste seufzte zufrieden.
Der letzte Ton verklang.
„Ich mag mich erinnern, als ich mit Frederic in das kleine Nebengebäude von Birmingham schlich, in welchem du damals jeden Morgen diese Suiten spieltest. Mama war ganz in Plaudereien mit Tante Isabel vertieft. Es war furchtbar aufregend den leisen Tönen zu folgen und dauerte unendlich lange, bis wir die rechten Türen öffneten. Zu unserem Glück übtest du immer sehr ausdauernd.“
Ihr Stiefvater lachte über Celestes Erinnerung. „Ja, es war überhaupt eine aufregende Zeit. Tante Isabel stand kurz vor der Geburt unserer Rebecca, dein Vater gab seit Monaten kein Lebenszeichen von sich und mein Haus war mit freundlichen Kindern angefüllt.“
Nachdenklich betrachtete Celeste ihren Stiefvater. „Während des Musizierens erholst du dich, nicht wahr?“
Mit einem Lächeln gab er es zu. „Aber nicht nur das, während des Musizierens ordnen sich meine Gedanken, ohne dass ich mich darum bemühen muss. Musik ist etwas Geheimnisvolles, etwas Göttliches.“
„Mein Lautenspiel war bis Dresden eine Selbstdarstellung. Erst dort habe ich Trost daraus schöpfen können. – Es war ein Entgleiten in eine andere Welt … ich wollte nicht mehr daraus erwachen. Applaus ist mir dort zuwider geworden.“ Sie lachte über sich selbst. „Wo ich zuvor so sehr danach strebte.“
„So lerntest du die wahre Tiefe der Musik erst in Dresden kennen.“
Sie nickte. „Wann lerntest du die Tiefe kennen?“
„Von Anbeginn war es meine Zuflucht. Dort konnte ich Kraft schöpfen.“
„Wovor musstest du fliehen?“, fragte sie verwundert. „Ein so vollkommener Mensch, wie du einer bist, muss doch aus einer tadellosen Familie erwachsen sein.“
Schmunzelnd sah er die junge und neugierige Dame an. „Nicht alles ist Gold, was glänzt.“
„War es dein Vater, der dir die Suppe versalzen hat?“
„Ich durfte viel durch ihn und an ihm lernen …“, sann er laut.
„Soso, an ihm! Das klingt wieder einmal undurchsichtig und damit vielversprechend. – Ich weiß nur, dass er Richter in Birmingham war. – Was war mit ihm?“
„Er gehörte dem gleichen Club an, wie der Stiefvater des Herrn von Heringsdorf.“
Celeste horchte auf. „Was ist das für ein Club? Bislang erzähltest du mir nichts davon und Herr Heinrich ebenso wenig.“
„Eine bösartige Vereinigung, die sich Wohltätigkeit auf die Fahne schreibt. Sie tun sehr gelehrt und menschenliebend, in Wahrheit sind sie die rechte Hand des Bösen. Die bevorzugte Klientel dieses Clubs sind Menschen, welchen das Ansehen und die Karriere wichtiger sind, als die Nächstenliebe. Vordergründig veranstalten diese Geheimbünde Wohltätigkeitsbälle und speisen die Armen, doch das ist nur Fassade. In allen einflussreichen Berufen pflegen sie ihre festen Bastionen, von welchen sie ihre hinterhältigen Tentakel ausstrecken, um neue Geldsklaven zu rekrutieren, und um ihre Einflussnahme und damit ihre Macht auszuweiten und zu festigen.“
Nie zuvor hörte Celeste den abgeklärten und stets maßvollen George Avestone in solcher Bitterkeit sprechen. Es schauderte sie. „Wann erfuhrst du von diesem Club?“
„Nun, ich kann dir kein genaues Datum nennen, doch bemerkte ich spätestens mit zehn Jahren, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging, und mit fünfzehn wurde es mir deutlich. Ich hegte früh den Wunsch, Recht zu studieren, und zwar insbesondere, um meinen Vater zu widerlegen. Als Kind ist man feinfühlig und empfindet Unebenheiten – besonders in der Ehe der Eltern …“. Er brach ab und blätterte in den Noten.
Sie spürte, dass er für sein Gleichgewicht eine Grenze überschritten hatte, die er nie überschreiten wollte. Es tat ihr leid, also kam sie auf ihre eigene Angelegenheit zu sprechen. „Warum bemühen wir das Gericht nicht noch einmal, Vater?“
Der Anwalt wiegte milde den Kopf. „Die Kirche hat entschieden. Man darf die Herrschaften nicht verärgern. Es ist etwas anderes, ob ein weltliches oder ein kirchliches Gericht entscheidet. Lass noch ein wenig Zeit ins Land gehen und dann schauen wir, ob sich etwas getan hat.“
„Was sollte sich tun?“
„Gottes Mühlen mahlen langsam, aber gründlich. Wir werden sehen.“
„Wie wird man über mich geurteilt haben, Vater? Darüber hast du mir nie etwas berichtet.“
„Herr Hofstetter ist das Opfer einer verwöhnten und launischen Gattin. – Ihn stört es nicht, dass die Ehe nicht aufgelöst wurde, seine Liebschaften sind auch ohnedies sündhaft …“.
„Meinst du, er sieht darin eine gerechte Strafe für mich?“
„Dieser Mann ist jenseits von irgendeiner Ordnung; die Frage ist, ob er überhaupt so viel darüber nachdenkt, dass er zu solchen Überlegungen kommen könnte.“
„Was denkst du über den Stiefvater von Herrn Heinrich?“
„Ein übler Geselle, der allein nach Einfluss und Macht strebt. Menschenleben sind ihm nicht viel wert. Nicht das der jungen Frau Hofstetter, nicht das des Sohnes und keinesfalls das Leben des Herrn Hofstetters – alles nur Spielfiguren, die nach Belieben eingesetzt und herumgeschoben werden.“
„Glaubst du, er würde mit seinen leiblichen Kindern auch so umgehen, wenn es ihm zupassekommt?“
„Vielleicht würde er einen kleinen Moment zögern, doch letztendlich würde er auch sie auf dem Altar der Macht opfern. Es ist eine Sucht, stets nach dem eigenen Vorteil zu schauen. Hat er einmal Blut geleckt, kann er sich diesem Sog nicht mehr entziehen.“
„Und Herr Jahner? Was ist das für ein Mensch?“
„Er ist Nutznießer. Selbst würde er diese Machenschaften nicht durchführen, doch lässt er andere gerne mutig für sich vorpreschen. Zu guter Letzt ist der andere Schuld, Herr Jahner ist sozusagen ‚unwissentlich‘ in etwas hineingeraten.“
Celeste dachte über die Tragweite des soeben Gehörten nach. „Herr Heinrich ist ein gerader Mensch, Vater. Er möchte keinem anderen Schaden zufügen, niemals, er ist sehr rücksichtsvoll. Und trotzdem ist er kein Mäuschen – er ist recht ungeniert.“
George Avestone lachte. „Das ist er. Er gefällt mir. Ich würde ihn gerne einmal persönlich kennenlernen.“
„Das möchtest du?“, entfuhr es Celeste überrascht.
„Selbstverständlich.“
„Und ich hatte den Eindruck, du bist nicht gar so unglücklich über den kirchlichen Schiedsspruch“, gestand sie verlegen.
„Das denkst du von mir?“, fragte er betroffen. „Ich sehe dich nicht gerne leiden – doch wenn ich alles getan habe, muss ich annehmen, was kommt.“
-

Die Verzögerung der Veröffentlichung des zweiteiligen Romans Gabriele ist durch nicht unerhebliche Veränderungen im Leben der Autorin bedingt. Da der Roman fertig in der Schublade liegt, wird er erscheinen, sobald die Verhältnisse es zulassen.
-
Vierte Kostprobe
Im Kreise der Familie erbrach Gabriele das Siegel des gerichtlichen Dokumentes und las es vor. Diese Vorgehensweise war der Vorschlag Heinrichs, da die Mutter kopflos vor allen amtlichen Schreiben zurückschreckte; nun bewältigten sie diese unangenehmen Angelegenheiten gemeinsam. „Um Gottes Willen! Wovon sollen wir denn leben?“, entfuhr es ihr verzweifelt. In diesem Schreiben wurde Gabriele eröffnet, dass das gesamte Vermögen des Ratsherrn bis auf Weiteres eingezogen werde, um die Schäden, die durch dessen Umtriebe entstanden waren, halbwegs wieder gutzumachen.
„Ab wann steht es dir nicht mehr zur Verfügung?“, fragte Heinrich.
„Hier steht, es ist schon festgesetzt …“, sprach Gabriele kläglich.
„Morgen werde ich mich nochmals bei Stöckl vorstellen … und auch an anderen Orten, Mutter. – Verzweifle nicht, es findet sich immer ein Weg.“
„Bis in den Juli werde ich die Kolbetöchter unterrichten. Kolbes sind überaus großzügig. – Also haben wir bis dahin auch ein wenig Geld“, tröstete Celeste.
„Oh, nein, Sie dürfen nicht mehr unterrichten, Celeste! Es ist zu anstrengend. – Heinrich, du musst deiner Gemahlin verbieten, noch so lange zu Direktor Kolbe zu gehen.“
Lächelnd tätschelte Heinrich Gabrieles Hand. „Sie besitzt ihren eigenen Kopf, Mutter.“
Zuvor in Gedanken vertieft, meldete sich plötzlich Ella-Luise zu Wort. „Wir haben verschiedenste unnütze Sachen herumstehen und eine Menge Silberbesteck, außerdem das Meisner Porzellan von der Großmutter von Schleiwitz – das könnten wir alles dem Pfandleiher übergeben.“ Gabriele begann still zu weinen. „Ich dachte, du hängst nicht an den Sachen?“, fragte die Jüngste verwundert.
„Das tue ich auch nicht …“, sagte Gabriele. „Es tut mir so leid, dass das alles geschehen muss, wo doch Celeste und Heinrich ihr Kindlein im Sommer bekommen sollen …“.

Am nächsten Tag ließ sich Gabriele ohne das Wissen der Familie zum Juwelier und Optiker Zeiss bringen. In Ihrem bestickten Beutel verwahrte sie das teure Collier, welches Othmar ihr zum dreißigsten Geburtstag schenkte, um vor seinen Logenbrüdern zu glänzen.
Geräuschlos trat sie in das Geschäft, wurde jedoch sogleich vom alten Zeiss erspäht. Freundlich kam er ihr entgegen. „Womit darf ich der gnädigen Frau dienen?“ Da Gabriele – gleich wie vor wenigen Monaten – kein Wort hervorbrachte, half er ihr. „Ein Schreiben an Fürst Moritz?“, fragte er gedämpft, während er sie zu einem bequemen Sessel in einem unbelebten Winkel führte.
Sie schüttelte den Kopf. „Nein … nein, nein!“ Fahrig hielt sie den Beutel hoch. „Hier … hier ist etwas drin, was ich Ihnen gerne wieder zurückgeben möchte … ich hab‘ es in den sechzehn Jahren wirklich nur einmal getragen … vielleicht könnten Sie mir … ein wenig Geld dafür geben …“.
Zweifelnd nahm Herr Zeiss das Beutelchen entgegen und warf einen Blick hinein. Er erkannte das aufwändig gearbeitete Collier sofort. Flink holte er ein kleines mit Samt bezogenes Tablett, zog vorsichtig die mehrreihige Halskette aus dem Säckchen und breitete sie darauf aus. Nachdenklich betrachtete er das Geschmeide und schüttelte den Kopf. „Verehrteste Frau von Heringsdorf, dieses Schmuckstück ist ein Vermögen wert.“
Scheu sah sie den angesehenen Goldschmied und Optiker an. „Ich möchte es veräußern. Sehen Sie eine Möglichkeit?“
„Tja, nun, ich muss darüber nachdenken. Wissen Sie, es ist ziemlich viel Geld – selbst ein betuchter Kaufmann gibt selten solch ein Vermögen für Geschmeide aus. Ich muss darüber nachdenken. Nehmen Sie es bitte wieder mit. Ich werde Sie in Kenntnis setzen, sobald ich eine Lösung gefunden habe.“
„Ich wäre Ihnen so dankbar, würden Sie eine Lösung finden … ich bin auf das Geld angewiesen.“ Die letzten Worte flüsterte sie.
-
Dritte Kostprobe

Vor sehr langer Zeit war Albert Kolbe ebenfalls Teilnehmer einer Jagdgesellschaft gewesen. Es war jedoch eine Gesellschaft anderer Art, die der Großvater aber mindestens ebenso schätzte wie seine adligen Gäste. Es war eine Schar von Studenten höheren Semesters. Am Tage wurde auf die Pirsch gegangen und am Abend bis in die Nacht disputiert. Die Gesellschaft blieb fünf Tage lang, es war herrlichster Altweibersommer. Sie war mit Heinrich oft draußen auf der Wiese an dem Vorplatz, wo der Kleine mit Wonne an dem niedrigen Mäuerchen spielte. Auf diesem Vorplatz sammelten sich stets die Gesellschaften vor der Jagd und bei warmem Wetter saß man dort an langen Bänken zum Mittagsbrot beisammen. Das Feldsteinmäuerchen bot Heinrich genau die richtige Höhe, damit er seine kleinen Tiegelchen daraufstellen und mit Bucheckern, Grashalmen und trockenen Fichtennadeln befüllen konnte. Seine Kinderfrau war stets in der Nähe und nahm den Kleinen mit, wenn er auf das Töpfchen musste oder Trost durch die Amme benötigte.
Das erste Frühstück seit deren Ankunft am Tage zuvor, das übrigens sehr spät ausfiel, wurde von den jungen Herren und dem Großvater auf diesem Vorplatz eingenommen. Offenbar hatte man bis tief in die Nacht zusammengesessen und die zweite Jagd verschoben. Sie war mit Heinrich bereits eine Weile draußen und glaubte die Gesellschaft schon verstreut im Wald. Geschäftig fingen die Bediensteten an, das Morgenbrot für zehn muntere Herren und deren Gastgeber auf den grob gehauenen Bänken zu richten. Heinrich jauchzte und half ebenso geschäftig mit, indem er an verschiedene Plätze seine Tiegelchen verteilte, die er zuvor emsig mit lauter Unrat befüllte. Ein junger Herr war eine viertel Stunde früher auf dem Vorplatz erschienen als seine Gefährten, offensichtlich um seine Brust mit frischer morgendlicher Waldluft zu füllen, dabei entdeckte er den kleinen Heinrich und genoss dessen munteres Hin und Her. Einmütig lachte er mit ihr über den drolligen Burschen, welcher den Dienern zwischen die Beine lief, um eifrig zu helfen. Unversehens kamen die anderen Herren auf den Platz, so dass sie es vorzog, den Ort zu wechseln. Das Kindermädchen hob den protestierenden Knaben aus dem Gewirr der langen Männerbeine und brachte ihn nach hinten in den Obstgarten zur Schaukel, wo sie ihren Sohn bereits erwartete. Als sie die Jagdgesellschaft in der Dämmerung heimkehren hörte, drängte es sie an das Fenster. Der junge Mann hatte sich am Morgen so herzlich über ihren Heinrich gefreut und sie so frisch angelächelt, dass sie ihn heimlich noch einmal betrachten wollte. Ob sie ihn unter den anderen wohl wiederkannte? Sogleich fiel er ihr ins Auge, obwohl nichts Besonderes an ihm war, er war nicht herausragend groß und auch nicht klein, die Frisur ganz ähnlich wie die der Kollegen, und die Kleidung, die eines einfachen Studenten. Es musste also tatsächlich die aufrichtige Freundlichkeit gewesen sein, die sie erwärmt hatte. Just in dem Moment, wo sie betrachtend in diese Gedanken versunken am Fenster stand, sah er hinauf. Sie erschrak und ging sogleich ein paar Schritte in das Dunkel des Zimmers zurück. Das Unglück, welches ihr vor drei Jahren widerfahren war, durfte sich keinesfalls nochmals wiederholen, das hatte ihr die gestrenge Mutter eingebläut. Am nächsten Morgen, der genauso schön erstrahlte wie jener zuvor, zog es sie wieder auf die Wiese am Mäuerchen. So war Heinrich glücklich und sie selbst war klüger geworden. An jenem Tage frühstückten die jungen Herren nicht draußen im Sonnenschein, trotzdem trat der Gestrige mit einem Buch in der Hand auf die Treppe zum Vorplatz. Er ließ seine Augen über den umliegenden Wald schweifen, der sich an diesem herrlichen Spätsommermorgen dampfend reckte; nach wenigen Sekunden entdeckte er sie und grüßte lächelnd, indem er kurz seine Mütze lüftete. Heinrich hantierte bereits geschäftig und brachte dem frühen Gast wankend ein gefülltes Tiegelchen, der neigte sich zu dem kleinen Kerl hinunter und nahm das Schälchen dankend entgegen. Er tat, als ob er den künstlichen Schmaus genüsslich verzehre, und rieb sich hernach das Wams. Heinrich quietschte vor Vergnügen und eilte, um eine neue Leckerei zu bringen. Das Kindermädchen wollte Heinrich daran hindern, doch gab sie der durch ein Zeichen zu verstehen, dass sie ihn gewähren lassen solle. Der junge Mann kam Heinrich entgegen, damit er nichts von seiner kostbaren Speise verschütte, und somit kam er auch in ihre Nähe. Als Heinrich ein drittes Mal zu seinem Küchenmäuerchen eilte, bekundete der junge Mann, dass so ein Kerlchen einem das Herz erwärme und die Mutter einen wahren Schatz unter ihren Fittichen habe. Sie spürte, wie sie darüber errötete, denn sie glaubte, er wolle ihr ein Kompliment machen. Erst später stellte sich heraus, dass er annahm, Heinrich sei das Kind der Erzieherin und nicht das ihre. Wie glücklich er strahlte, als sie ihm später gestand, dass Heinrich ihr Sohn sei. So einen Jungen könne sich jeder Mann nur wünschen, rief er damals aus. Drei Monate nach ihrer ersten Begegnung im Jagdschlösschen des Großvaters hielt er in Dresden um ihre Hand an. Mindestens ebenso viele Monate dauerte es, bis sie nicht mehr weinen musste, wenn sie an ihn dachte. Das strickte Nein der Mutter war unumgänglich, niemals würde diese die einzige Nachkomme des Maximilian von Schleiwitz einem Bürgerlichen zur Gemahlin geben. – Doch besaß sie auch ihren Dickkopf, ihren kostbaren Heinrich würde sie unter allen Umständen mit in eine Ehe nehmen und sei es der Kaiser von China persönlich, der um ihre Hand anhalten werde, oder sie wolle für immer ledig bleiben.
-

-
Zweite Kostprobe
Der Kaffeetisch wurde mit großer Sorgfalt und viel Liebe hergerichtet, voll freudiger Erwartung halfen viele Hände tatkräftig mit. Sonnenflecken tanzten auf dem, mit zart rosa Blüten der Clematis und blauen Flockenblumen geziertem Tuch und dem feinen Porzellan – und alles war überspannt von dem lichten freundlichen Grün der Glyzinien. Als erster Gast erschien Herr Theodor von Birnbaum. Er war ein junger Mann von vierundzwanzig Jahren, hatte sein Studium der Theologie vor einem halben Jahr abgeschlossen und absolvierte nun sein Vikariat unter den Fittichen des Pastoralrates, Pastor Bodmer, in der Frauenkirche. Er war von stillem und bescheidenem Wesen und verehrte die etwas spröde Cäcilia schon seit drei Jahren. Der Wirbel um den Ratsherrn hatte ihn nicht aus der Ruhe gebracht, denn sein Vater war selbst Mitglied der Loge und erklärte ihm, dass der König das Gras wachsen höre. Mit seinem Freitod habe der Ratsherr zwar wahrhaftig übertrieben, kaum wäre ihm etwas nachzuweisen, aber er war nun einmal ein gewissenhafter Mann gewesen, dem die ganze Angelegenheit zu nahe gegangen sei.
Nun war die Zeit bereits fortgeschritten und Ella-Luise bangte um das Kommen des Grafen. Alles hatte sie sich so hübsch ausgemalt, sogar den ‚Tanzsaal‘ hatte sie mit kleinen Girlanden ausgeschmückt.
„Ich denke, wir sollten schon Platz nehmen, vielleicht ist Graf Bronsky etwas dazwischengekommen. – Was denkst du, Mutter?“, wandte sich Heinrich an Gabriele, die am Fenster in der Sonne stand und in die Krone der Linde sah. Sie pflichtete ihrem Sohn bei und lud alle nach draußen in den Garten ein. Fräulein Agnes und ein Dienstmädchen trugen Kuchen und eine Torte auf und brachten den heißen Kaffee. Artig lauschte Theodor den Mädchen, die ihm freudig von dem Ablauf des belehrenden Tanzvergnügens berichteten, wobei Cäcilia ihre jüngere Schwester ab und zu in die Schranken weisen musste.
„Hoffentlich kommt er noch, sonst ist alles umsonst!“, jammerte Ella-Luise schließlich.
„Nein, es ist nicht umsonst“, schmunzelte Celeste verschmitzt. „Cäcilia spielt den Walzer, Herr von Birnbaum wendet ihr die Notenblätter und du tanzt mit Heinrich, während ich euch Anweisungen gebe.“
„Oh, nein, liebe Schwägerin, kommt gar nicht in Frage“, widersprach Cäcilia mit erhobenem Zeigefinger. „Du wirst deine Laute bemühen, eben doch Tanzmusik hervorzubringen, und dann werden Theodor und ich zum Tanze schreiten und Ella-Luise begnügt sich mit Heinrichs Tanzkünsten!“
Ella-Luise klatschte in die Hände. „Das ist eine fantastische Idee!“ Sie stutzte plötzlich. „Aber dann fehlt der Tanzlehrer …“.
„Ist dieser Graf Bronsky ausgewiesener Tanzlehrer?“, fragte Theodor misstrauisch.
„Ja. – Er unterrichtet seit vierzig Jahren im Hospital für Kriegsversehrte“, bestätigte Ella-Luise gewichtig.
Verunsichert sah Theodor in die Runde. Die Schwägerin nickte ernst, Frau von Heringsdorf sah zerstreut auf dem Tisch umher, der älteste Sohn des Ratsherrn lächelte breit und Cäcilia sah mit zusammengepressten Lippen auf ihren Teller, um nicht laut zu lachen. Da trat Fräulein Agnes in den Garten und kündigte Graf von Bronsky an. Die jungen Leute sprachen freudig durcheinander. Gabrieles Herz schlug ängstlich rascher, was jedoch keiner hörte.
Ein auffällig vornehmer und schöner Herr kam den gepflasterten Gartenweg auf die Laube zu und verneigte sich zur Begrüßung lächelnd. Rasch sah Ella-Luise zu Theodor und triumphierte innerlich. „Verzeihen Sie vielmals meine Verspätung, Frau Gabriele! Leider wollte man mich so schnell nicht ziehen lassen, ich musste zu einigen Angelegenheiten noch Rede und Antwort stehen.“ Heinrich führte den Grafen an den freien Platz.
„Haben die Herrschaften im Versehrtenhospital Sie gar zu sehr in Anspruch genommen?“, bedauerte Ella-Luise den Grafen.
„Wie meinen, Verehrteste?“, fragte der mit schmalen Augen.
„Na, letzthin erzählten Sie doch, wie unersättlich die Gebrechlichen im Hospital immer wieder den Walzer erlernen und tanzen wollen …“. Mit ernster Miene beschwor sie ihn. „…, so dass Sie schon einmal Reißaus nehmen mussten, obwohl der königliche Kommerzienrat zugegen war, um Ihre tänzerischen Künste zu überprüfen …“.
Des Grafen Miene hellte sich erinnernd auf und er lachte. „Ja, ja, diese Woche war es wieder entsetzlich; besonders die beinlosen Herrschaften können nicht genug kriegen. – Ich habe meinen Rückzug aus diesem anspruchsvollen Geschäft bereits angekündigt.“
Cäcilia prustete, Heinrichs Gesicht verriet amüsiertes Staunen und Celeste wiegte bewundernd den Kopf über den Schalk ihrer jungen Schwägerin, aber auch die Gewandtheit des Grafen beeindruckte sie zunehmend.
Der Graf ließ den Blick über den Garten und das Innere der Laube schweifen. „Was für eine herrliche Laube und was für ein bezaubernder Kaffeetisch“, freute er sich. „Genau danach steht mir nach dieser anstrengenden Woche der Sinn!“ An den weiß lackierten Pfeilern, die das lichte Dach hielten, wanden sich neben Glyzinie, Geißblatt und Clematis. „Ich wusste gar nicht, dass Frau Gabriele solch ein Kleinod hinter dem Hause pflegt!“ Freundlich lächelte er sie an. „Aber ich hätte es mir eigentlich denken können.“
Der rasche und aus heiterem Himmel getriebene Schabernack hatte Gabrieles Geisteskräfte überstiegen, doch jetzt, wo der Graf sich dem widmete, was sie erfüllte, öffnete sich ihr Verstand. „Danke“, sagte sie leise.
Nun entdeckte der Graf in der Runde den jungen Herrn neben Cäcilia. „Ah, ein unbekanntes Gesicht!“ Er erhob sich ein wenig. „Bronsky mein Name!“
„Angenehm, Theodor von Birnbaum.“ Auch Theodor lüpfte seinen Allerwertesten ein paar Zentimeter.
Die beiden Töchter von Heringsdorf verteilten den Kuchen und man begann nun auch den Tanzlehrer in die Überlegungen der Vorgehensweise einzuweihen. Während Graf von Bronsky den Mädchen entgegenkommend zuhörte, musterte der junge Prediger den hinzugekommenen Gast. Ihm war, als hätte der Vater diesen Namen Bronsky schon einmal in einem unangenehmen Zusammenhang erwähnt, doch wollte es ihm nicht in den Sinn kommen.
-
Erste Kostprobe
„Graf Bronsky ist nicht nur ein famoser Tänzer, zudem verehrt er dich, Mutter!“ Ella-Luise bemühte sich, ihrer Mutter am Frühstückstisch ihre Beobachtung vom Abend darzulegen. „Also, ich an seiner Stelle wäre wahrhaftig gekränkt.“
„Ella-Luise, es ist ein Hirngespinst; du wünscht es dir, und darum …“.
Zurückweisend schüttelte Luischen den Kopf. „Mutter! Ich könnte jetzt zu Hoffmanns gehen, zu Ehepaar Rasokat, eigentlich zu allen, die gestern am Ball teilgenommen haben; alle würden mir bestätigen, dass unser Tischherr dir ganz besondere Aufmerksamkeit schenkte.“
„Es ist selbstverständlich, dass der Tischherr seinen Damen besondere Aufmerksamkeit schenkt, es wäre peinlich …“.
Frau Hoffmann trat an den Tisch von Mutter und Tochter von Heringsdorf. Entgegenkommend lächelte sie. „Darf ich mich noch für einen Kaffee zu Ihnen setzen, meine Damen?“, fragte sie, während sie sich bereits niederließ. „Mein Gatte hat heute Morgen seine kleine Trinkkur in der Karlstherme.“ Gabriele nickte ergeben, hingegen Ella-Luise die Stirne ein wenig kraus zog. „Der Ball war wirklich gelungen, meine Damen, nicht wahr – so gute Musiker und so ein charmanter Tanzmeister!“ Zufrieden wiegte sie den Kopf. Schließlich musterte sie die stille Frau von Heringsdorf. „Aber jetzt muss ich Sie wirklich einmal fragen, wer der beeindruckende Herr an Ihrer Seite war, Frau von Heringsdorf? Man sagte mir gestern zu später Stunde, er sei Ihr Bruder …!“ Zweifelnd hob sie die Augenbrauen. „Doch irgendwie kann ich das kaum glauben.“ Verschworen lächelte sie und neigte sich vor. „Obwohl er solch prächtige blonde Haare trägt wie Sie, Verehrteste.“
Hilfesuchend sah Gabriele ihre Tochter an.
„Er ist mein Cousin – also eigentlich mein Großcousin!“, antwortete Ella-Luise unbefangen.
„Also Ihr Cousin, Frau von Heringsdorf?“
„Nein, er ist der Cousin des verstorbenen Verlobten meiner Mutter“, erklärte Luischen wichtig. Gabriele wollten die Sinne schwinden. Frau Hoffmanns Gesicht verzog sich ungläubig. Doch dann lachte sie fröhlich. „Das wird mir jetzt wahrhaftig zu verstiegen! – Wie heißt denn der werte Herr?“
„Er ist ein von Bronsky“, flüsterte Ella-Luise bedeutungsvoll.
„Von Bronsky …“, sann Frau Hoffman nach. „Ist das Dresdner Adel oder kommt er aus Polen?“
„Selbstverständlich aus Dresden! Es ist eine sehr berühmte Familie mit vielen Verbindungen zum Königshaus.“
„Was Sie nicht sagen, kleines Fräulein!“ Argwöhnend musterte Frau Hoffmann die Mutter des jungen Mädchens. Diese saß versteinert auf ihrem Stuhl und sah ausdruckslos in die Ferne.
Ein Diener trat an den Tisch und bot Gabriele auf einem kleinen silbernen Tablett eine Visitenkarte dar. „Verehrte Dame, Graf von Bronsky wünscht Sie zu sprechen.“
Da Gabriele begriffsstutzig auf das Tablett starrte, nahm Ella-Luise die Angelegenheit in die Hand. „Führen Sie ihn sogleich an unseren Tisch und bringen Sie noch ein Gedeck, bitte!“
„Sehr wohl, gnädiges Fräulein!“
Wenige Augenblicke später trat Graf von Bronsky mit freudigem Strahlen an den Tisch. „Guten Morgen, meine Damen! Ich hoffe, Sie haben nach diesem erfreulichen Ball wohl geruht!“ Höflich verneigte er sich.
„Schauen Sie, Herr Graf, es ist bereits für Sie gedeckt!“, begrüßte Ella-Luise stolz den Cousin. „Setzen Sie sich bitte!“,
„Vielen Dank!“ Ein Diener schenkte ihm Kaffee ein und fragte nach seinen Wünschen. „Ein Kaffee genügt, ich habe bereits gefrühstückt.“
Zögernd erhob sich Frau Hoffmann. „Nun gut, verehrter Herr Graf, ich möchte nicht weiter stören. Gewiss möchten Sie mit Ihren Cousinen noch einiges klären …“.
„Cousinen?“ Graf von Bronsky lachte einnehmend. „Das ist auch einmal ein hübscher Verwandtschaftsgrad! Die Wahrheit ist, Frau von Heringsdorf ist meine Schwägerin und es ist tatsächlich so, dass ich noch das eine oder andere vor meiner Abreise mit diesen teuren Damen klären muss.“
Ella-Luise bekam glühende Wangen, unterdrückte jedoch ein vergnügtes Glucksen. Frau von Heringsdorf schien mit den Gedanken immer noch an einem anderen Ort zu weilen. Frau Hoffmann zog sich mit einem kleinen Knicks endlich zurück.
Freundlich wandte sich Graf von Bronsky an Gabriele. „Ich möchte Ihnen für den schönen Abend danken, Frau Gabriele, und mich bei Ihnen verabschieden. Leider muss ich bereits schon heute wieder zurück nach Chemnitz – ich hatte gehofft, wenigstens noch den Nachmittag mit Ihnen verbringen zu dürfen …“.
Gabriele sah unruhig vom Grafen zu Ella-Luise und wieder zurück und senkte schließlich den Blick. Auf einen kleinen Wink des Grafen verließ Ella-Luise den Tisch. „Wohin gehst du, Ella-Luise?“, rief Gabriele ihr kleinmütig hinterher.
Luischen eilte zurück. „Ich bin sofort wieder da, ich möchte Graf Bronsky nur etwas vom Zimmer holen“, beruhigte sie die Mutter lächelnd und verschwand.
„Ja, dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise, Herr Graf … wann kehren Sie nach Dresden zurück?“, versuchte Gabriele, höflich Konversation zu treiben.
„Ich werde vor Ihnen wieder in Dresden sein, Frau Gabriele, und hoffe sehr, Sie dort bald wieder zu sehen.“ Die Stimme des Grafen war ernst und verbindlich.
-
Der Gemahlin des Dresdner Ratsherrn, Gabriele von Heringsdorf, begegnen wir das erste Mal in dem Roman Celeste oder Ankunft in Dresden. Sie ist eine zurückhaltende und ängstliche Frau. Beinahe wirkt sie dümmlich und ist auch selbst von ihrer Dummheit überzeugt. So wie man es ihr von Jugend an einbläute.
Nicht nur ihr erstgeborener Sohn weiß, dass das nicht wahr ist. Ein Ehrenmann weiß mehr, als alle anderen – und weiß bereits, bevor er sie selbst persönlich kennenlernen durfte, wer Gabriele wirklich ist.
Als eines Tages das Unfassbare eintritt und nach fünfundzwanzigjähriger Ehe der Tod an des rücksichtslosen Ratsherrn Türe klopft, winkt Gabriele die große Freiheit zu. Doch statt zuzupacken, fällt sie in tiefe Trostlosigkeit.
Bevor Gabriele erkennt, dass ein echter Freund ihr die Hand reicht, versucht sie den vermeintlichen Handlanger ihres verstorbenen Gatten abzuwehren.
Unbeeindruckt führt dieser Gabriele aus ihrem seelischen Gefängnis. Dabei unterstützen ihn mit viel Esprit und Ungeduld Ella-Luise, ihre jüngste Tochter, und der zartfühlende Künstler Heinrich von Heringsdorf.
-
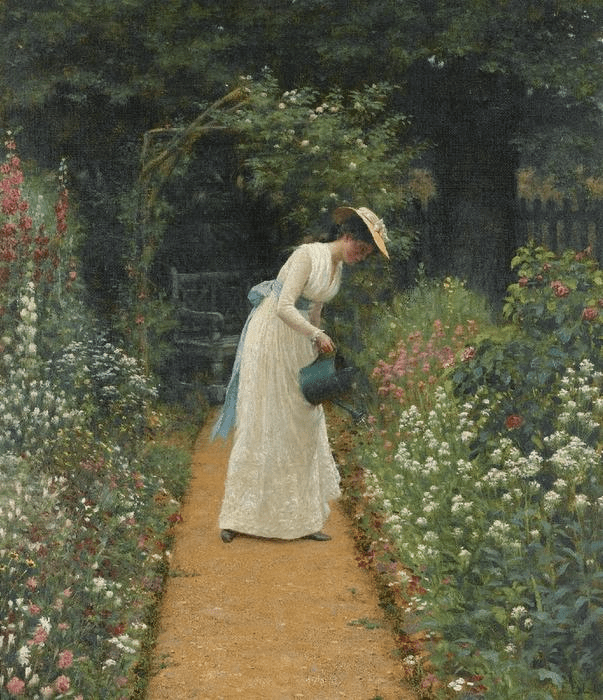
Während Katharina Auciel an einem neuen Werk arbeitet, korrigiert sie den im Februar erscheinenden zweiteiligen Roman: Gabriele – Das Angebot einer Freundschaft.
-
Sie hatte es geschafft! Siebenzehn Tage nach ihrer Abfahrt aus Dresden stand Celeste erschöpft vor dem Themseweg 8 in Chelsea und hatte soeben am Klingelzug gezogen. Nach wenigen Sekunden öffnete sich die Tür und freundlich sah ihr die Hauswirtschafterin entgegen. Plötzlich riss die überrascht die Augen auf und entließ einen Schreckenslaut. „Celeste! Kind, kommen Sie herein! Um Gottes willen! Was ist geschehen? Ihre Mutter … so warten Sie einen Moment …“.
„Beruhigen Sie sich, Frau Moss! Holen Sie einfach meine Mutter. Ich finde mich schon zurecht.“
In diesem Augenblick ging die Tür des Wohnzimmers bereits auf und entgeistert trat Anna in die kleine Halle. Eilig kam sie ihrer Tochter entgegen und drückte ihr geliebtes Kind an sich. So lagen sich beide schluchzend eine Weile in den Armen. Frau Moss zog sich still zurück, um dem Dienstmädchen Anweisungen für Celestes Zimmer zu geben und selbst ein Essen vorzubereiten; eindeutig musste das Kind kräftig genährt werden.
Anna half ihrer Tochter aus Jäckchen und Schuhen, führte sie in das Wohnzimmer und ließ sich mit ihr auf das Sofa nieder. „Liebstes Kind! Warum ist mir das Glück so hold, dass ich dich in den Armen halten darf? – Was haben wir uns gesorgt! – Liebste, erzähl alles!“
Celeste zog die Beine hoch, legte ihren Kopf in den Schoss der Mutter und seufzte. „Bei dir sein zu dürfen, Mama, das ist das höchste Glück.“ Sie schloss die Augen und schlief augenblicklich ein.
Endlos fuhr Anna liebkosend über Gesicht und Haar ihres tapferen Töchterchens; was musste ihr Mädchen ausgestanden haben? Hatte sie die weite Reise von Dresden nach London ganz allein unternommen oder war ihr Gatte mitgereist und noch geschäftlich unterwegs? – Nein, ihr Himmelsgeschenk sah ganz abgezehrt aus, sie roch sogar ein wenig streng, das heißt, sie war allein gereist und hatte somit einige Strapazen auf sich genommen. Armes Kind!
Die Wohnzimmertür ging auf und Betsy trat mit Magdalena an der Hand herein. Lenchen machte sich los und eilte zur Mama, auf deren Schoß eine Fremde lag. Mama hielt den Finger an die Lippen. Vorsichtig betrachtete sie die Frau. „Das ist Celli, Mama!“, rief die Kleine endlich froh.
„Ja, das ist unsere Celli! Sie ist ganz erschöpft von der langen Reise, wir wollen sie schlafen lassen“, flüsterte Anna. Vorsichtig hob sie die Schultern ihrer Ältesten an. „Helfen Sie mir, Betsy!“
Mit der umsichtigen Hilfe der leise schniefenden Betsy konnte Anna ihren Platz verlassen, ohne Celeste geweckt zu haben. Behutsam deckte sie die tief schlafende Frau Ingenieur Hofstetter mit einer Wolldecke zu, um mit Dienstmagd und Jüngster das Wohnzimmer zu verlassen.
Anna richtete mit Marie das Zimmer für Celeste, ihren Koffer ließ sie hochbringen und entnahm ihm alle Schmutzwäsche und die zerknitterten Kleider und übergab sie Marie für den Waschtag, alle anderen Utensilien ließ sie unberührt darin liegen. Schließlich holte sie von Celeste abgelegte Kleider aus der Truhe vom Speicher und gab sie der Dienstmagd zum Auslüften und Plätten. Alle halbe Stunde schlich sie in das Wohnzimmer und betrachtete staunend ihre Tochter. Was hatte sie sich das ganze Jahr gesorgt; ihre plaudernde und herzausschüttende Älteste war hinter einer frohgemut scheinenden Fassade nahezu stumm geworden. Bereits nach den ersten Wochen ihrer jungen Ehe erwähnte sie kaum den Gemahl, was Anna wahrlich beängstigte, denn in nahezu jedem Brief klang Einsamkeit und manchmal sogar Schlimmeres durch. Celestes Zurückhaltung konnte nur mit einem Leid zusammenhängen, dass sie eisern zu verschweigen gedachte. Während des verflossenen Jahres hatte Anna mit ihrem Gatten alle in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgesprochen, doch letztendlich erklärte der ihr Schultern hebend, es müsse Celestes eigener Wunsch sein, sich zu öffnen, und nur dann könne man ihr behilflich sein. Seit Dezember bot sie ihr in jedem Brief an, mit Magdalena nach Dresden zu kommen, sie würde auch in einem Gasthaus wohnen, wenn es ihr lieber wäre. Scheinbar unbeschwert lehnte diese jedes Angebot ab. – Nun war sie endlich da! Zu ihrem Kummer gab Celestes Zustand ihren Befürchtungen recht. Doch spätestens am nächsten Morgen würde sie hoffentlich alles erfahren.
„George, unsere Celeste ist da!“ Mit dieser ungewöhnlichen Nachricht empfing Anna ihren Gemahl am Abend bereits an der Tür.
Ungläubig schüttelte er den Kopf. „Erlaubst du dir einen Scherz mit mir?“
„Komm!“ Sie führte ihn in das Wohnzimmer, in dem Celeste seit vier Stunden tief und fest schlief.
Der Anwalt ließ sich zum Sofa führen, er beugte sich vor und nickte. „Sie ist es tatsächlich! – Sie riecht ein wenig streng.“
„Das arme Kind war auf dieser langen Reise ganz auf sich gestellt – ist es da ein Wunder?“ Annas Augen füllten sich wieder mit Tränen. „Stell dir vor, was muss sie erlebt haben, dass sie ohne Ankündigung hier vor der Tür steht!“
George Avestone nahm seine Frau in die Arme. „Jetzt haben wir sie bei uns, Anna.“
(Seite 208 – 210)
Zum Inhalt springen


